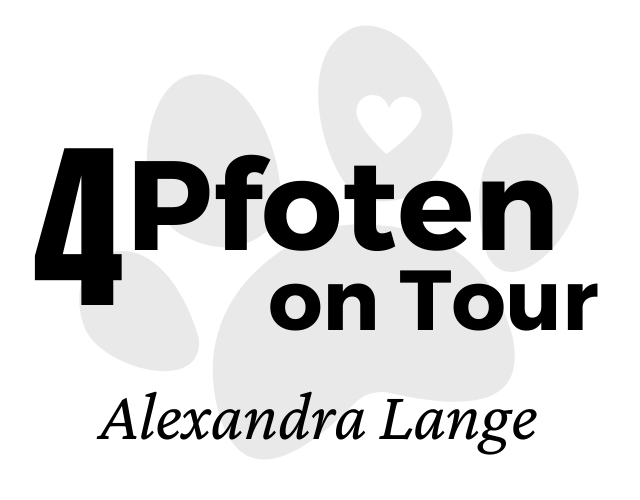„Hunde machen das untereinander doch auch so.“
Ein Satz, der schnell gesagt ist. Er klingt logisch, natürlich und irgendwie fair. Genau deshalb wird er so gern benutzt – vor allem dann, wenn es um strenge, grobe oder konfrontative Handlungen gegenüber dem Hund geht. Er taucht auf, wenn Grenzen diskutiert werden, wenn Druck ausgeübt wird, wenn Maßnahmen gerechtfertigt werden sollen, die sich für den Hund unangenehm oder übergriffig anfühlen. Und oft bleibt es genau dabei: beim Satz. Ohne genau hinzuschauen, was er eigentlich bedeutet.
Denn je genauer man hinsieht, desto deutlicher wird: Dieser Vergleich hinkt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern grundsätzlich.
Hunde sind keine Tiere, die ständig auf Auseinandersetzung aus sind. Im Gegenteil. Für die meisten Hunde ist Konflikt etwas Unangenehmes. Er kostet Energie, erhöht das Verletzungsrisiko und bedeutet Stress. Sozial kompetente Hunde versuchen deshalb, Konflikte möglichst früh zu vermeiden. Sie beschwichtigen, verlangsamen ihre Bewegungen, drehen den Kopf weg, gehen auf Abstand oder weichen aus. All diese feinen Signale haben ein Ziel: Ruhe herstellen, Spannung abbauen, Eskalation verhindern. Sicherheit, Vorhersagbarkeit und ein möglichst konfliktarmes Miteinander sind für Hunde zentrale Bedürfnisse.
Wenn wir Hunde beobachten, die scheinbar „klar Grenzen setzen“, sehen wir häufig nur den letzten Teil einer langen Kette. Wir sehen das Knurren, das Blocken oder das Abschnappen – aber nicht all die vielen kleinen Signale davor, die vielleicht übersehen oder ignoriert wurden. Was dann als „typisch hundisch“ oder als konsequente Korrektur interpretiert wird, ist in Wahrheit oft bereits der Notausgang.
Wenn Hunde deutlich werden, geht es dabei nicht um Erziehung. Knurren, Abwehren oder Abschnappen sind keine pädagogischen Maßnahmen. Sie sind Ausdruck von Überforderung, Unsicherheit, Angst oder Schmerz. Oder sie dienen dem Schutz wichtiger Ressourcen – Futter, Spielzeug, Liegeplätze, Abstand, soziale Nähe oder auch Mauselöcher. Das Ziel des Hundes ist dabei nicht, dem anderen Hund etwas beizubringen oder ihn nachhaltig zu verändern. Es geht um eine einzige, sehr klare Botschaft: Diese Situation soll aufhören. Jetzt.
Hunde handeln in solchen Momenten aus Selbstschutz, nicht aus pädagogischem Anspruch. Sie regulieren ihr eigenes Wohlbefinden. Mehr nicht.
Das zeigt sich besonders deutlich beim Thema Ressourcen. Wenn Hunde Ressourcen verteidigen, dann tun sie das für sich und für diesen Moment. Es geht nicht um eine bessere Zukunft, nicht um Regeln, nicht um langfristige Lernziele. Ob es um Futter, Liegeplätze, Abstand oder soziale Nähe geht – der Hund reagiert situativ auf das, was er gerade empfindet. Die Vorstellung, ein Hund würde dabei einen anderen „erziehen“, entsteht erst in unserem menschlichen Kopf. Hunde haben kein moralisches Konzept von richtig oder falsch. Sie haben keine Trainingspläne. Sie wollen keine „besseren Hunde“ aus anderen machen.
Ihr Verhalten ist immer an den Moment gebunden. An das, was sie fühlen, wahrnehmen und aushalten können. Wer darin Erziehung sieht, vermischt menschliche Denkmodelle mit tierischem Verhalten.
Ein weiterer Punkt wird bei diesem Vergleich fast immer übersehen: Hunde können so handeln, weil sie Hunde sind. Wir können es nicht. Hunde verfügen über ein hochdifferenziertes Kommunikationssystem, das uns Menschen schlicht nicht zur Verfügung steht. Sie kommunizieren über feinste Körpersignale – minimale Spannungsänderungen, Blickrichtungen, Muskeltonus, Gewichtsverlagerungen. Diese Signale laufen blitzschnell, gegenseitig abgestimmt und in einem gemeinsamen Bedeutungssystem ab.
Menschen hingegen sind grober in ihren Bewegungen, langsamer in ihren Reaktionen und oft widersprüchlich in ihrer Körpersprache. Was unter Hunden noch als klar und angemessen verstanden wird, kann durch einen Menschen schnell bedrohlich, verwirrend oder massiv übergriffig wirken. Das Machtgefälle kommt hinzu: Wir sind größer, schwerer, kontrollieren Ressourcen, Räume und Entscheidungen. Selbst wenn wir es nicht wollen, handeln wir immer aus einer Position der Überlegenheit heraus.
Wenn wir konsequent wären, müssten wir den Vergleich „Hunde machen das untereinander doch auch so“ eigentlich zu Ende denken. Wir schnüffeln nicht am Hinterteil unseres Hundes, um Informationen zu sammeln. Wir untersuchen keine Pippistellen, um zu erfahren, wer hier war. Wir markieren keine Bäume, stellen keine Ohren auf und klemmen nicht die Rute ein. Warum nicht? Weil uns der passende Körper, der gemeinsame Kontext und die geteilte Bedeutung fehlen. Dass Hunde bestimmte Dinge untereinander tun, macht sie nicht automatisch zu einer sinnvollen oder verständlichen Strategie im Mensch-Hund-Zusammenleben.
Mensch-Hund-Beziehung ist kein Hund-Hund-Kontakt. Wir sind keine Artgenossen unserer Hunde, und unsere Rolle ist eine andere. Wir müssen nicht nachahmen, korrigieren oder maßregeln. Unsere Aufgabe liegt im Schutz, im Management und in der Orientierung. Wir tragen Verantwortung für Situationen, für Rahmenbedingungen und für das emotionale Erleben unserer Hunde. Nicht Nachahmung schafft Sicherheit, sondern Verlässlichkeit.
Der Satz „Hunde machen das untereinander doch auch so“ sagt am Ende weniger über Hunde aus als über menschliche Unsicherheit. Über den Wunsch nach einfachen Erklärungen, klaren Regeln und schnellen Rechtfertigungen. Hunde regeln nicht die Erziehung anderer. Sie regeln ihr eigenes Wohlbefinden.
Wir müssen nicht verzweifelt versuchen ,Hunde nachzuahmen.
Es reicht aus, sie erstmal nur besser zu verstehen. 💛